Wissen
Auf dieser Seite finden Sie Informationen, Materialien und nützliches Wissen.
Wenn Sie Rückmeldungen an uns haben, kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auf den Austausch.
Was ist Belästigung?
Das Gleichbehandlungsgesetz definiert Belästigung als Verhalten, das die Würde der betroffenen Person verletzt oder dies bezweckt, für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht und anstößig ist und dadurch für diese Person ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes Umfeld schafft oder dies bezweckt.
Beispiele:
– wiederholte körperliche Annäherungen, die zufällig erscheinen;
– unangemessene Briefe, Anrufe, Nachrichten oder Geschenke;
– sexuelle Anspielungen, obszöne Witze, Gesten und Kommentare;
– Nachstellen, Verfolgen oder Bedrängen;
Was ist sexuelle Belästigung?
Sexuelle Belästigung ist ein konkretes, sexuell bestimmtes Verhalten, das unerwünscht ist und durch das sich eine Person unwohl und in ihrer Würde verletzt fühlt.
Als sexuelle Belästigung gelten unter anderem sexualisierende Bemerkungen und Handlungen, die entwürdigend bzw. beschämend wirken, unerwünschte körperliche Annäherung, Annäherungen in Verbindung mit Versprechen von Belohnungen und/oder Androhung von Repressionen. Damit ist sie unter anderem ein Mittel zur Machtausübung, bei dem Machtgefälle bzw. Abhängigkeitsverhältnisse einseitig sexualisiert und damit aufrechterhalten werden.
Das Gleichbehandlungsgesetz im Arbeitsleben definiert sexuelle Belästigung als
ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten, das die Würde einer Person
beeinträchtigt oder dies bezweckt und für die betroffene Person unerwünscht,
unangebracht oder anstößig ist. Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn dieses Verhalten von Arbeitgebenden, Kolleg*innen oder Dritten (z. B. Kund*innen) an den Tag gelegt wird, oder wenn der/die Arbeitgeber*in es schuldhaft unterlässt, eine angemessene Abhilfe zu schaffen.
Was ist Machtmissbrauch?
Unter Machtmissbrauch versteht man das unrechtmäßige Ausnutzen einer beruflichen, institutionellen oder persönlichen Position, um eigene Interessen durchzusetzen oder andere zu benachteiligen.
Dazu zählen vielfältige unethische und moralisch verwerfliche Verhaltensweisen.
Beispiele für Machtmissbrauch (exemplarisch):
– Abhängigkeiten ausnutzen (Befristungen, Rollen oder Förderzusagen als Druckmittel,…)
– Druck und Sanktionen (Drohungen, Ausschluss aus Projekten, Honorarkürzungen nach Kritik,…)
– Arbeitszeit und Sicherheit (Einsätze trotz Ruhezeiten, Missachtung von Arbeitsschutz und Sicherheit,…)
– Sexualisierte Grenzverletzungen (Übergriffe, sexualisierte Sprache, intime Szenen ohne Einwilligung,…)
– Reframing und Gaslighting (Grenzverletzungen als „künstlerische Zumutung“ argumentieren, Schuldumkehr,…)
– Informationsmacht und Intransparenz (Zurückhalten von Daten, unklare Kriterien, fehlende Protokolle,…)
– Zuständigkeiten umgehen (Entscheidungen außerhalb von Verfahren, informelle Hierarchien,…)
– Ausschluss und Herabwürdigung (Isolation aus Teams und Kanälen, öffentliche Demütigung,…)
– Finanzielle Kontrolle (Vetternwirtschaft, willkürliche Gagenkürzungen,…)
– Kompliz*innenschaft (Wegsehen und Decken von Fehlverhalten durch Funktionsträger*innen,…)
– Fragerecht abwerten (Rückfragen als Illoyalität abwerten, Kritik pathologisieren,…)
Machtmissbrauch kann rechtliche Dimensionen haben, etwa im Rahmen des Gleichbehandlungsgesetzes, des Strafgesetzbuches oder anderer Diskriminierungsbestimmungen.
Nicht jedes unethische oder respektlose Verhalten ist jedoch juristisch angreifbar.
Machtmissbrauch bleibt ein gesellschaftliches Problem, das über das Recht hinausgeht.
Was ist Gewalt?
Gewalt hat verschiedene Erscheinungsformen. Darunter fallen physische Gewalt, psychische Gewalt, ökonomische Gewalt und sexualisierte Gewalt.
Gewalt ist ein Verhalten, durch das Menschen körperlich oder seelisch verletzt, bedroht, eingeschüchtert oder kontrolliert werden. Es geht dabei immer um die Ausübung von Macht, gegen den Willen oder zum Nachteil anderer.
Gewalt bedeutet nicht nur körperliche Übergriffe. Auch Worte, Handlungen oder Strukturen können Gewalt sein, wenn sie Menschen entwerten, einschränken oder abhängig machen.
Gewalt kann sein:
– Körperlich (z. B. Schläge, Festhalten)
– Psychisch (z. B. Drohungen, Kontrolle)
– Sexuell (z. B. Übergriffe ohne Einwilligung)
– Ökonomisch (z. B. Kontrolle und Missbrauch durch Geld oder Vertragswesen)
– Strukturell (z. B. Diskriminierung durch Systeme)
– Digital (z. B. Cybermobbing, Überwachung)
Gewalt beginnt dort, wo die Würde eines Menschen verletzt wird, jemand sich nicht mehr frei entscheiden oder sicher fühlen kann und Abhängigkeit ausgenutzt wird.
Was ist Diskriminierung?
Diskriminierung meint die Benachteiligung von Personen aufgrund bestimmter Merkmale wie zum Beispiel Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Behinderung, sexuelle Orientierung, etc.
Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verbietet Diskriminierungen insbesondere wegen:
– Geschlecht
– Ethnischer Herkunft oder zugeschriebenen ethnischen Merkmalen
– Hautfarbe
– Sozialer Herkunft
– Genetischer Merkmale
– Sprache
– Religion oder Weltanschauung
– Politischer oder sonstiger Überzeugung
– Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit
– Vermögen
– Geburt
– Behinderung
– Alter
– Sexueller Orientierung
Darüber hinaus ist jede Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit innerhalb des Anwendungsbereichs der EU-Verträge verboten.
Der Begriff „insbesondere“ bedeutet, dass auch andere Gründe erfasst sind, die zu Benachteiligung führen können.
Wir verweisen auf die Charta der der Grundrecht der EU
Was bedeutet Grenzverletzung?
Grenzverletzungen entstehen, wenn persönliche Grenzen nicht respektiert werden. Sie können subtil auftreten, etwa durch respektlose Sprache oder Ausgrenzung, oder schwerwiegend, etwa in Form von Diskriminierung oder sexueller Belästigung.
Persönliche Grenzen sind individuell, weil sie sich aus den eigenen Erfahrungen, Werten, Bedürfnissen und dem Wohlbefinden einer Person ergeben.
Nicht jede Grenzverletzung ist rechtlich verfolgbar.
Organisationen haben jedoch die Verantwortung, klare Strukturen zu schaffen, in denen Grenzen ernst genommen werden können. Dazu gehören unter anderem Sensibilisierung, klare Abläufe und eine offene Kommunikationskultur.
Materialien zum Download
-
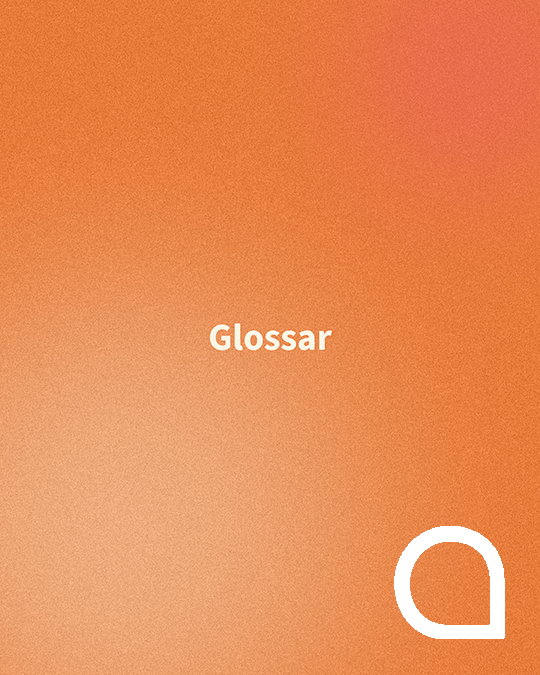
Glossar
Unser Glossar lädt ein, neugierig zu bleiben, Missverständnisse auszuräumen und gemeinsam sprachlich sicherer zu werden.
Download -
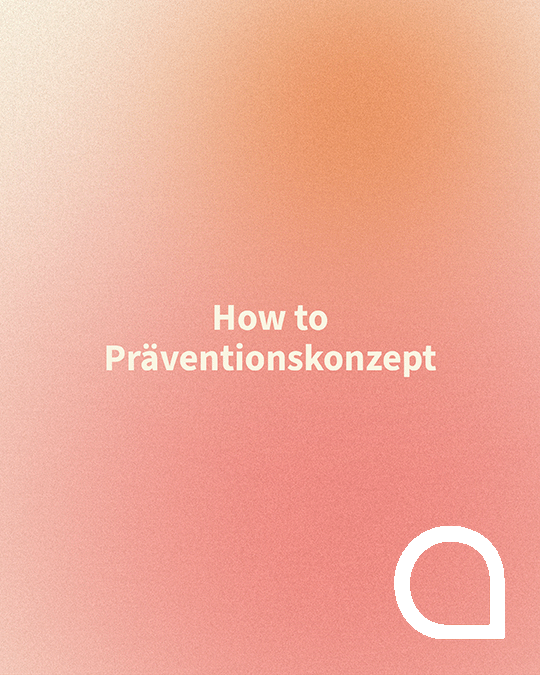
How to Präventionskonzept
Diese Broschüre soll einen kompakten Einstieg in die Entwicklung eines Präventionskonzepts im Kunst- und Kulturbereich anbieten.
Download -
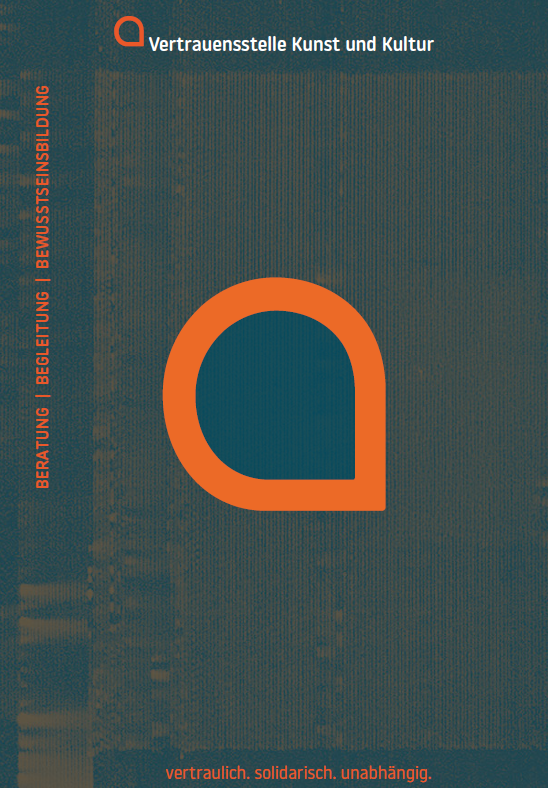
Flyer Allgemeine Informationen Anlaufstelle
vera* Allgemeine Info Anlaufstelle
Download
Anlaufstellen für Betroffene und Vertrauenspersonen
- Soforthilfe für akute Krisen gewaltinfo.at
- Frauenhelpline (Mo-So, 0–24 Uhr, anonym und kostenlos): 0800 222 555
- Männerinfo (Mo-So, 0–24 Uhr, anonym und kostenlos): 0800 400 777
- Telefonseelsorge (Mo-So, 0–24 Uhr, vertraulich und kostenlos): 142
- Gewaltschutzzentren (anonym und kostenlos): 0800 700 217
Hilfreiche Unterstützung
- ACT4RESPECT Kostenlose und anonyme Information bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
- Arbeiterkammer (AK) – gesetzliche Interessensvertretung für Arbeitnehmer*innen, bietet Beratung zu arbeitsrechtlichen Fragen
- GAW Gleichbehandlungsanwaltschaft
- Weisser Ring – Verbrechensopferhilfe, psychosoziale und juristischer Prozessbegleitung
- Younion – Interessenvertretung von künstlerisch, journalistisch, programmgestaltend, technisch, kaufmännisch und administrativ tätigen Personen in Kunst, Medien und Sport
- #we_do – Ombudsstelle für Film und Fernsehen
- Viele Interessensgemeinschaften der Branche bieten umfangreiches Wissen und Unterstützungsangebote. Eine Übersicht unserer Mitglieder finden Sie unter „Über uns„
Nützliches Wissen
- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
- Charta der Grundrechte der EUROPÄISCHEN UNION
- Rechtliche Grundlagen der Gleichbehandlung – Sammlung der wichtigsten rechtlichen Grundlagen für die Gleichbehandlung
- Istanbul Konvention – Das erste völkerrechtlich verbindliche Instrument zur umfassenden Bekämpfung aller Formen von Gewalt an Frauen
- Fairness Codex des Bundesministeriums für Kunst und Kultur in Österreich
